Klimakleber strafbar als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch Festkleben auf der Fahrbahn. Das Kammergericht (Urt. v. 02.06.2025 – 3 ORs 22/25) wertet das Festkleben mit Sekundenkleber als „Gewalt“ i.S.d. § 113 StGB.
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durch Festkleben
Das KG stuft das Festkleben mit Sekundenkleber als „Gewalt“ nach § 113 StGB ein, weil der Kleber ein materielles Zwangsmittel sei, das Adhäsionskräfte erzeugt und das spätere(!) Wegtragen nur unter erheblichem Kraftaufwand oder chemischen Hilfsmitteln erlaubt. Zugleich grenzt sich der 3. Strafsenat ausdrücklich vom OLG Dresden ab: Ob die Polizei reißt oder chemisch den Kleber löst, darf nicht über die Strafbarkeit entscheiden – andernfalls hänge der Tatbestand vom „Zufall“ der polizeilichen Räumungstaktik ab.
Dem KG ist insoweit zuzustimmen, als es keinen Unterschied machen darf, ob die Polizei den Kleber chemisch oder mit Gewalt löst.
Das Ergebnis kann in beiden Varianten jedoch nur lauten: Nicht strafbar
Der vom KG angenommene Gewaltbegriff überschreitet die Grenzen von § 113 StGB. Strafbarer Widerstand erfordert eine auf den Beamten gerichtete, unmittelbare körperliche Kraftentfaltung.
Das selbstbezogene „Passivmachen“ (Sitzen, Ankleben) erhöht zwar den Räumungsaufwand, übt aber keinen unmittelbaren Zwang gegen den Vollstreckungsbeamten aus. Damit wird ziviler Ungehorsam, untechnisch gesprochen passiver Widerstand, künstlich kriminalisiert. Passivität, auch in angeklebter Form, ist das genaue Gegenteil von körperlicher Kraftentfaltung bzw. Kraftäußerung gegen die Person des Vollstreckenden.
Passiver Widerstand als politisches Mittel darf nicht pauschal kriminalisiert werden, solange keine Strafgesetze verletzt werden, namentlich insbesondere § 240 StGB.
Die weite Lesart droht das Bestimmtheitsgebot (Art. 103 II GG) zu unterlaufen, weil nahezu jede Form der Erschwernis – abhängig von polizeilichen Maßnahmen – zur „Gewalt“ werden könnte, und sie setzt zudem ein empfindlich scharfes Sanktionsregime für überwiegend friedliche Protestformen frei, was in seiner abschreckenden Wirkung auf Art. 8 GG problematisch ist.
Dogmatisch inkonsistent, verfassungsrechtlich heikel und kriminalpolitisch überzogen.
*:Der Begriff der Gewalt in § 113 Abs. 1 StGB wird enger als bei der Nötigung ausgelegt, er ist beschränkt auf den Einsatz physisch wirkender Zwangsmittel. Erforderlich ist eine durch tätiges Handeln bewirkte Kraftäußerung, die gegen die Person des Vollstreckenden gerichtet und geeignet ist, den Vollzug der Vollstreckungshandlung zu erschweren oder zu verhindern.
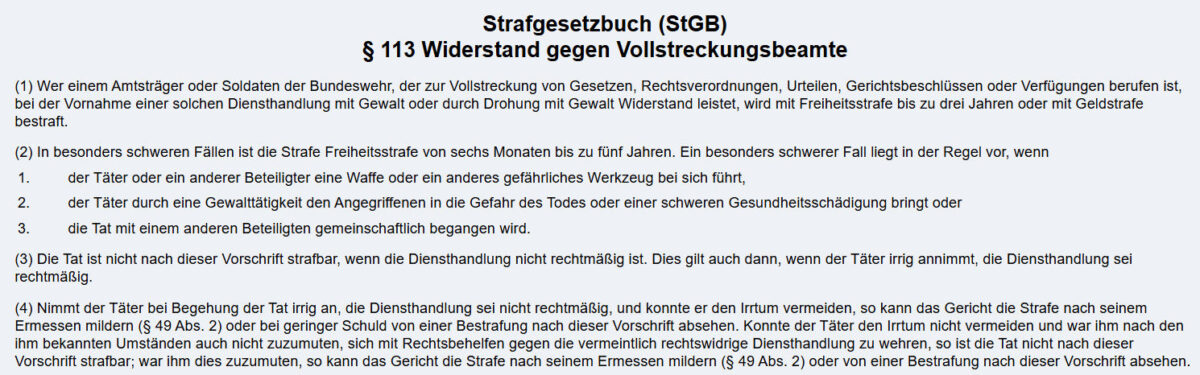
Kernaussagen des Kammergerichts
„… Der Senat hat für vergleichbare Fallkonstellationen bereits entschieden, dass der vom Täter verwendete Sekundenkleber ein materielles Zwangsmittel und dessen Verwendung … Gewalt im Sinne des § 113 Abs. 1 StGB darstellt, die geeignet ist, die Vollendung der Diensthandlung … zumindest zu erschweren.“
„Durch das Auftragen des Klebers … werden Adhäsionskräfte erzeugt, die später nicht ohne Weiteres … gelöst werden können. … Die mittelbare Kraftentfaltung … wirkte auch noch im Zeitpunkt der Vollstreckungshandlung.”
„Erforderlich sei lediglich, dass das ‚vorweggenommene tätige Handeln‘ als ‚gezielte Vorbereitung einer Widerstandshandlung‘ erscheine.“
(unter Verweis auf BGHSt 18, 133; Rn. 4)
„Die vom OLG Dresden vorgenommene Differenzierung [zwischen chemischer Lösung und Reißen] erscheint willkürlich; sie führt zu Zufallsergebnissen.“
(Rn. 7)
Zentral ist die Gleichsetzung des Sekundenklebers mit einem materiellen Zwangsmittel: Der Beschuldigte erzeuge eine physische Barriere, die die Polizei nur unter erheblichem Kraftaufwand oder chemisch überwinden könne; dies genüge für „Gewalt“.
2. Dogmatische Kritik
a) Gewaltbegriff – Bruch mit der Sitzblockaden‑Linie
Die Rechtsprechung setzt für Widerstand eine gegen den Beamten gerichtete unmittelbare Kraftentfaltung voraus. Beim Festkleben wirkt die Adhäsionskraft gegen die Fahrbahn, nicht gegen die Person.
b) Unechtes Unternehmensdelikt und „vorweggenommene“ Gewalt
§ 113 StGB ist ein unechtes Unternehmensdelikt: Das KG akzeptiert, dass zwischen Klebevorgang und Räumung Stunden vergehen können. Damit verlagert sich die Strafbarkeit weit von der eigentlichen Konfliktsituation weg – ein Wertungswiderspruch, den das Gericht selbst einräumt, aber nicht auflöst.
c) Objektive Zufallsklausel
Das KG verwirft die Sicht des OLG Dresden, wonach es auf die tatsächlich aufgewandte Kraft ankommen müsse. Indem es jeden Klebeeinsatz zur Gewalt erklärt, macht es die Strafbarkeit von der Wahl der AktivistInnen unabhängig – doch faktisch bleibt sie von der polizeilichen Taktik abhängig: Wird sofort Lösungsmittel benutzt, fehlt jede Kraftentfaltung; das Delikt wäre rein fiktiv. Das Bestimmtheitsgebot (Art. 103 II GG) verlangt jedoch Vorhersehbarkeit.
3. Verfassungsrechtliche Einwände
Art. 8 GG (Versammlungsfreiheit) – Passiver Protest wird durch die Androhung hoher Freiheitsstrafen faktisch entmutigt (Chilling effect).
Verhältnismäßigkeit – Mildere Mittel stehen zur Verfügung (§ 240 StGB, Polizeirecht). Eine Kriminalisierung auf Widerstands‑Niveau ist nicht erforderlich, um Blockaden zu begegnen.
Art. 103 II GG (nullum crimen) – Wenn jede Erschwernis abstrakt reicht, mutiert „Gewalt“ zum willkürlichen Begriff. Das Urteil verwischt die dogmatische Grenze zwischen körperlich‑aktiver Gewalt und passiv‑beharrlichem, nicht strafbarem zivilen Widerstand.
4. Ausblick
Das Kammergericht hat wegen der Divergenz zum OLG Dresden von einer Vorlage an den BGH abgesehen. Eine höchstrichterliche Klärung bleibt damit offen – doch angesichts der massiven Rechtsfolgen erscheint sie unausweichlich. Bis dahin entsteht eine Rechtsunsicherheit für Polizei und Protestierende gleichermaßen.
„Es wäre sachwidrig und ungerecht … die Strafbarkeit … von der Eigenart der polizeilichen Reaktion abhängig zu machen.“
(RN. 8; gleichwohl führt das Urteil genau zu dieser Problematik.)
5. Resümee
Das Kammergericht wagt einen drastisch erweiterten Gewaltbegriff: Jede selbstverursachte physische Barriere genügt. Dieser Ansatz kollidiert mit geltender BGH‑Rechtsprechung, überdehnt § 113 StGB dogmatisch und verletzt verfassungsrechtliche Schutzlinien. Die Entscheidung markiert damit keinen dogmatischen Fortschritt, sondern einen Rückschritt in Richtung Strafrechtsausweitung auf überwiegend friedliche Aktionsformen. Eine Korrektur durch den Bundesgerichtshof oder den Gesetzgeber erscheint geboten.